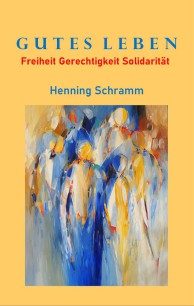Am 18. Mai 1848 trat in Frankfurt zum ersten Mal die
deutsche Nationalver-sammlung zusammen.
Es war die Geburtsstunde der deutschen Demokratie. Sie überlebte nur etwas mehr als ein Jahr bis zur Kapitulation der Freiheitskämpfer in der badischen Festung Rastatt vor den preußischen Truppen am 23. Juli 1849.
1933 hat »der Nationalsozialismus in der Demokratie mit der Demokratie die Demokratie besiegt.« So Hitler im Originalton.
Heute im Jahr 2023 ist die Demokratie in Deutschland und vielen anderen Staaten der Welt wieder bedroht und von populistischen Ideologien durchsetzt oder hat sich bereits hin zu illiberalen, autokratisch-populistischen und faschistischen Staatsformen entwickelt. Es lohnt sich also, genauer hinzusehen und deren Charakteristika herauszu- arbeiten.
Es ist Zeit die Demokratie neu mit Leben zu füllen.
Leserempfehlung: DEMOKRATIE LEBEN!
"...Geradezu eine Pflichtlektüre für politische Bildung in der aktuellen Situation." (Herbert Kramm-Abendroth)
Das Buch öffnet die Augen für das, was wichtig ist im Leben.
"Wenn wir Neues schaffen wollen, müssen wir uns von dem bloß passiv-betrachtenden Denken, dem Zukunft fremd ist, lösen. Wir müssen
den Willen zum Verändern der Welt,in der wir leben aufbringen und den Mut haben, unser Wissen und Denken auf die noch ungewordene Zukunft ausrichten."
(aus: GUTES LEBEN, S. 330)
Spannender histori-scher, biografischer Roman über Olympe de Gouges: Warum nicht die Wahrheit sagen.
»Ich bin eine Frau. Ich fürchte den Tod und eure Marter. Aber ich habe kein Schuld-bekenntnis zu machen. Ist nicht die Meinungs-freiheit dem Menschen als wertvollstes Erbe geweiht?«
So verteidigte sich Olympe de Gouges vor dem Revolutionstribunal in Paris. Eine kompromisslose Humanistin, eine sinnliche, lebenslustigeund mutige
Frau, die der Wahrheit unter Lebensgefahr zum Recht verhelfen will und als erste Frau in der Geschich-te auch für das weibliche Geschlecht die Bürger-rechte einfordert. Die Zeit vor und während der Französischen Revolution gewinnt in dieser historisch-authentischen Gestalt Lebendigkeit und atmosphärische Dichte.
Piano Grande
Ein Roman über die Liebe in Zeiten der Krise.
Der Roman Piano Grande
zeichnet ein eindringliches Porträt des ersten Jahr-zehnt dieses Jahrhunderts, in dem die Finanz- und Wirtschaftskrise die Welt an den Rand des Abgrunds brachte.
Der Roman wirft auf dem Hintergrund einer großen Liebesgeschichte "einen sezierenden Blick auf die Gesellschaft und ihre Eliten..., die die Welt im Jahr 2008 in eine wirtschaftliche Kata-strophe geführt haben ..." (Wetterauer Zeitung)
Als vertiefende Ergänzung zu dieser Wirtschafts- und Finanzkrise empfehle ich Ihnen meinen Essay: Demokratischer Marktsozialismus. Ansätze zu einer bedürnisorientierten sozialen Ökonomie.
(Käthe Kollwitz)
Was ist das für ein demo-kratisches System, das unfähig ist, den Mord-versuch vom 6. Januar 2021 an ihrer Demokratie zu ahnden?
Unter Nice-to-now habe ich für Sie Ausschnitte aus der Rede von Trump zur Wahl und den Sturm auf das Kapitol zusammen-gestellt.
Besuchen Sie auch meine Autorenseite Henning Schramm auf Facebook. Ich würde mich freuen, wenn sie Ihnen gefällt.
Ich möchte mich auch über das rege Interesse an meiner Homepage mit über 400.000
Besucherinnen und Besuchern bedanken.
Die Alarmglocken der Demokratie schrillen
Henning Schramm
Auf dem Hintergrund des Desasters bei der Landratswahl in Sonneberg, wo die AfD nun den Landrat stellen kann, und der politischen Großwetterlage allgemein, braut sich etwas zusammen, was die Demokratie nachhaltig gefährden kann. Wenn mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland unzufrieden damit ist, wie die Demokratie in unserem Land funktioniert, und wenn fünfzehn bis zwanzig Prozent der Bevölkerung (das liegt in der Größenordnung, die die NSDAP 1930 an Stimmen bekam) sogar einen radikalen Bruch mit der liberalen Demokratie anstreben, müssen bei allen Demokraten die Alarmglocken läuten. Diejenigen, die AfD wählen, rekrutieren sich, wie eine Analyse des Sozialforschungsinstitut Sinus ergeben hat, immer mehr aus der Mitte der Gesellschaft. Lag der Anteil bürgerlicher Wähler und Wählerinnen bei den Stimmen der AfD 2021 bei 43%, so stieg dieser Anteil bis 2023 auf 56%. Die AfD wird also zunehmend hoffähig und die rechtsextremen Parolen und Inhalte gewinnen an Akzeptanz.
Mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sind die Einstellungen der Bevölkerung zum Rechtsextremismus dort von besonderem Interesse, da sie Auswirkungen auf Deutschland insgesamt haben werden. Die im Juni 2023 veröffentlichten Ergebnisse des Leipziger Instituts für Demokratieforschung an der Universität Leipzig[1] verdeutlichen eindrucksvoll, in welchem Ausmaß extrem-rechte Parteien, namentlich die AfD, mit ihren ideologischen Angeboten zahlreiche Anknüpfungspunkte in die Breite der Bevölkerung haben. „Da sich die meisten Menschen mit einem geschlossen rechtsextremen Weltbild bisher nicht entscheiden können, an den Wahlen teilzunehmen, liegt hier noch weiteres Potenzial für extrem-rechte und neonazistische Parteien“, schreiben die Autoren der Studie[2].
Fragt man nach den Gründen für die Affinität zu rechtsextremen Angeboten, so macht man es sich zu leicht, diese in einer Protesthaltung zu suchen. Neben sozial-ökonomischen Gründen sind vor allem sozialpsychologische Ursachen ausschlaggebend für die beobachteten rechtsextremen Einstellungen. Sie sind gefährlicher für die Demokratie und schwerer zu beheben – und nicht auf die neuen Bundesländer beschränkt. Die größte Erklärungskraft für rechtsextreme Haltungen bieten eine Verschwörungsmentalität und der Wunsch nach autoritärer Unterwerfung. Es zeigt sich, so die Analyse der Studie, dass sich derzeit viele Menschen in den ostdeutschen Bundesländern nicht mehr demokratische Teilhabe und Sicherung der demokratischen Grundrechte wünschen, sondern die scheinbare Sicherheit einer autoritären Staatlichkeit.
‚Was Deutschland jetzt braucht, ist eine starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert‘. Diesem Statement stimmen etwas mehr als die Hälfte der Ostdeutschen zu (26,3% manifest/24,9% latent). ‚Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert‘, befürworten insgesamt ein Drittel der Befragten (14% manifest/19,1 latent). ‚Im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform‘, stimmen immer noch knapp ein Drittel der Befragten zu (8,6, manifest/22,1% latent).
All diese Menschen befürworten eine Neo-NS-Ideologie und die damit zusammenhängenden sozialdarwinistischen, antisemitischen und rassistischen Einstellungen, wie zum Beispiel das Statement ‚wie in der Natur sollte sich in der Gesellschaft immer der stärkere durchsetzen‘, dem insgesamt 34,9% der Befragten zugestimmt haben. Oder: 'Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen' (31,7%). Und: 'Es gibt wertvolles und unwertes Leben' (27,7% Zustimmung).
Diejenigen, die solchen Aussagen zustimmen, vereint die Sehnsucht nach einem autokratischen Führungsstil und Führer und nationaler und rassischer Überlegenheit, gepaart mit chauvinistischem Gehabe (‚Das oberste Ziel deutscher Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen‘, 53,6% Zustimmung), das einem Demokraten die Haare zu Berge stehen müssen.
Die Unzufriedenheit mit der Demokratieerfahrung im Alltag ist besonders ausgeprägt. Nicht einmal die Hälfte der Befragten zeigt sich hier zufrieden. Fragt man nach der Sinnhaftigkeit politischer Partizipation, so ist das Erscheinungsbild der erlebten Demokratie noch verheerender. Nur eine Minderheit meint, auf die Regierung Einfluss zu haben: Nicht einmal ein Vierteil der Bevölkerung ist dieser Ansicht. Die Autoren der Studie schlussfolgern daraus: „Für den Zustand der Demokratie ist die gravierende politische Deprivationserfahrung ein Warnzeichen – unabhängig davon, ob man hierfür tatsächlich fehlende Mitgestaltungsmöglichkeiten oder aber unterschiedliche Vorstellungen, was Demokratie ist, verantwortlich macht. Die Ergebnisse berühren unmittelbar die Legitimation des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, ist doch in einer liberalen Demokratie die Teilnahmemöglichkeit zentral.“[3]
Was die liberale Demokratie anbietet, ist die Erfahrung von Freiheit, Gerechtigkeit und Vielfalt der existierenden Lebensformen. Dazu muss sie mit den Bürgerinnen und Bürgern in einen Dialog eintreten über die offensichtlichen Diskrepanzen und Widersprüchlichkeiten der Welt, die sozialen Ungerechtigkeiten, wie auch die zukünftigen Möglichkeiten und Herausforderungen und sucht nach gemeinsamen Lösungsansätzen. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung (und nicht nur in Ostdeutschland), so scheint es, glaubt nicht mehr an das demokratische Angebot und den notwendigen Dialog darüber.
Wirft man einen genaueren Blick auf diese nationalistisch-chauvinistische gefärbte, rechtsradikal-rassistische Szene, so scheint heute die in der Demokratie überwunden geglaubte Sehnsucht nach Unterwerfung unter eine Autorität wieder populär zu werden. Es drängt sich unter diesem Blickwinkel die Frage auf, was den Menschen dazu führt, sein Leben anderen Händen anzuvertrauen, statt es in die eigenen zu nehmen. Verstärkt gar die Delegierung von Verantwortung und die Aufgabe von Eigeninitiative das Wohlbefinden? Wie würde, wie müsste Politik und Gesellschaft darauf reagieren?
Um darauf eine Antwort zu finden, lohnt sich ein kurzer Blick auf Kant und die Aufklärung. Aufklärung darüber, wie Unterdrückung den Menschen deformiert, was Freiheit für jeden Einzelnen bedeutet, wie sie erlangt werden kann und was Unfreiheit dem Menschen vorenthält. Der kritische Geist der Aufklärung ist aufgefordert, die Un-Wahrheit aus dem Verborgenen herauszuholen und ins Licht zu stellen, sich mit den Mächten auseinanderzusetzen, die Menschen vernünftige Wege von der Unmündigkeit zur Mündigkeit und Freiheit versperren.
Immanuel Kant macht sich in seiner Schrift von 1784 ‚Was ist Aufklärung?‘ auch Gedanken darüber, was zur Unmündigkeit führt und warum es auf der anderen Seite einzelnen politischen Führern so leicht gemacht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Nach Kant sind die Motive für eine solche Einstellung fehlender Mut und Gedankenfaulheit. Ich möchte als weitere aktuelle Triebfeder hinzufügen: Unterwerfung unter ein Potpourri mächtiger Gefühlslagen wie Angst, Resignation, Selbstzweifel und Selbstwertverfall (der in Ostdeutschland stärker ausgeprägt sein dürfte als in Westdeutschland, aber natürlich auch hier in bestimmten Milieus zum Tragen kommt). Sie lähmen den Verstand und die Vernunft und verschatten die Wahrheit. Die historische Erfahrung in Deutschland und anderswo scheint die These von Kant zu bestätigen. Und sie gilt bis heute, erweitert um Begriffe wie Gleichgültigkeit, Borniertheit und Populismus
Zum Wesen der Demokratie gehört, dass jedem Einzelnen die Verantwortung für sich und die Gemeinschaft auferlegt ist. Der Einzelne muss den Willen und den Mut haben, Verantwortung für das Ganze zu übernehmen. Wer sich zum Wurm macht, muss sich nicht wundern, dass er mit Füßen getreten wird, sagte einst der Königsberger Philosoph, und er hat recht mit dieser Äußerung. Ein der Demokratie verpflichtetes Subjekt muss sich Rechenschaft nicht nur über sein Tun ablegen, sondern auch über sein Denken. Er muss die Verantwortung für Konsequenzen seines Handelns und seines Denkens für sich und die Gemeinschaft, in der er lebt, wie auch darüber hinaus für die Erde insgesamt bedenken.
Ein Handeln, das sich allein im formalen Akt des Wählens (oder auch des Nichtwählens, des Sich-Verweigerns) und nicht im verantwortlichen Handeln und Denken ausdrückt, schützt nicht vor Unfreiheit und Despotismus. Es sei daran erinnert, dass die Nazis formal demokratisch gewählt worden waren. Das deutsche Volk hat sie ermöglicht, geduldet und für gut befunden, wie eine unabhängige Umfrage dokumentierte: Hitlers Diktatur erreichte Ende des Jahres 1933 eine Zustimmungsrate von 88 Prozent. Es lohnt sich in dieser Hinsicht auch Hitlers Reden zum 30. Januar 1933 zu lesen. In der im Berliner Sportpalast 1941 gehaltenen Rede zur Bedeutung dieses Datums erläuterte Hitler seine Strategie für seinen Siegeszug: »Der Nationalsozialismus hat in der Demokratie mit der Demokratie die Demokratie besiegt.«
Die Demokratie ist ein fragiles Gebilde. Sie hat keine feste Form. Sie hat auch keinen Meister, keinen Schöpfer. Sie ist etwas, das ständig gelebt werden muss. Sie hat keine uneinnehmbaren Mauern um sich gebaut, sondern ist bezwingbar und zerstörbar, wenn die Bürgerschaft nicht wachsam ist oder sie der Lebensform Demokratie überdrüssig wird. Demokratie erfordert von allen Beteiligten Einsichtsfähigkeit, Wissen, Vertrauen und Mut zu Kompromissen, um sie funktionsfähig zu halten. Man kann sich Demokratie als einen mit Vergangenheit, Erwartungen, Hoffnungen und Zukunft gefüllten, geistigen Raum vorstellen, der ständig in Bewegung ist. Sie impliziert eine politische Ordnung, die erlernt werden muss und nicht verordnet oder gar befohlen werden kann.
Ohne aufgeklärte, mutige Bürgerinnen und Bürger ist Demokratie nicht lebensfähig. Sie fordert politische Teilhabe in allen Lebensbereichen und strebt nach Aufhebung der Begrenzungen von Berechtigungsräumen der Teilhabe, der Teilnahme und gesellschaftlichen Gestaltungschancen. Demokratie ist die Arena, in der der Kampf um das demokratische Versprechen nach Angleichung der Lebensverhältnisse und (Zukunfts-)Offenheit, in der das Noch-nicht-Gewordene und das in Zukunft Mögliche ausgehandelt wird. In dem Jetzt liegen die Sedimente der Vergangenheit wie auch die Bausteine einer möglichen Zukunft, die subjektiven und objektiven Hoffnungsinhalte und noch unentdeckten Wahrheiten. Ungewordene Zukunft ist in der Vergangenheit sichtbar, die Zukunft selbst erscheint als Möglichkeit in der Gegenwart. Das, was wird, wird aus dem, was ist, im dialektischen Kampf zwischen dem Neuen mit dem Alten.
Demokratie, die nicht nur passiv-betrachtend das Gewordene verwaltet, sondern im Gewordenen das Zukünftige zu entdecken und das Gegebene zu ändern versucht, wird so zum aktiven Gestalter des Morgen. Sie kann Utopien generieren und Ideen entwickeln, wie die Welt von Morgen aussehen könnte, nicht aus reinen Gedankenexperimenten heraus, sondern auf der Basis des geschichtlich entstandenen materiellen und geistigen Lebensraums, den wir liberale Demokratie nennen.
[1]
Institut für Demokratieforschung an der Universität Leipzig. EFBI Policy-Paper 2023-2: Autoritäre Dynamiken und die Unzufriedenheit mit der Demokratie. Die Rechtsextreme Einstellung in den
Ostdeutschen Bundesländern.
Die Erhebungszahlen stammen aus dem Jahr 2022
[2] Policy Paper, S. 2
[3] Policy-Paper 2023-2, S. 21